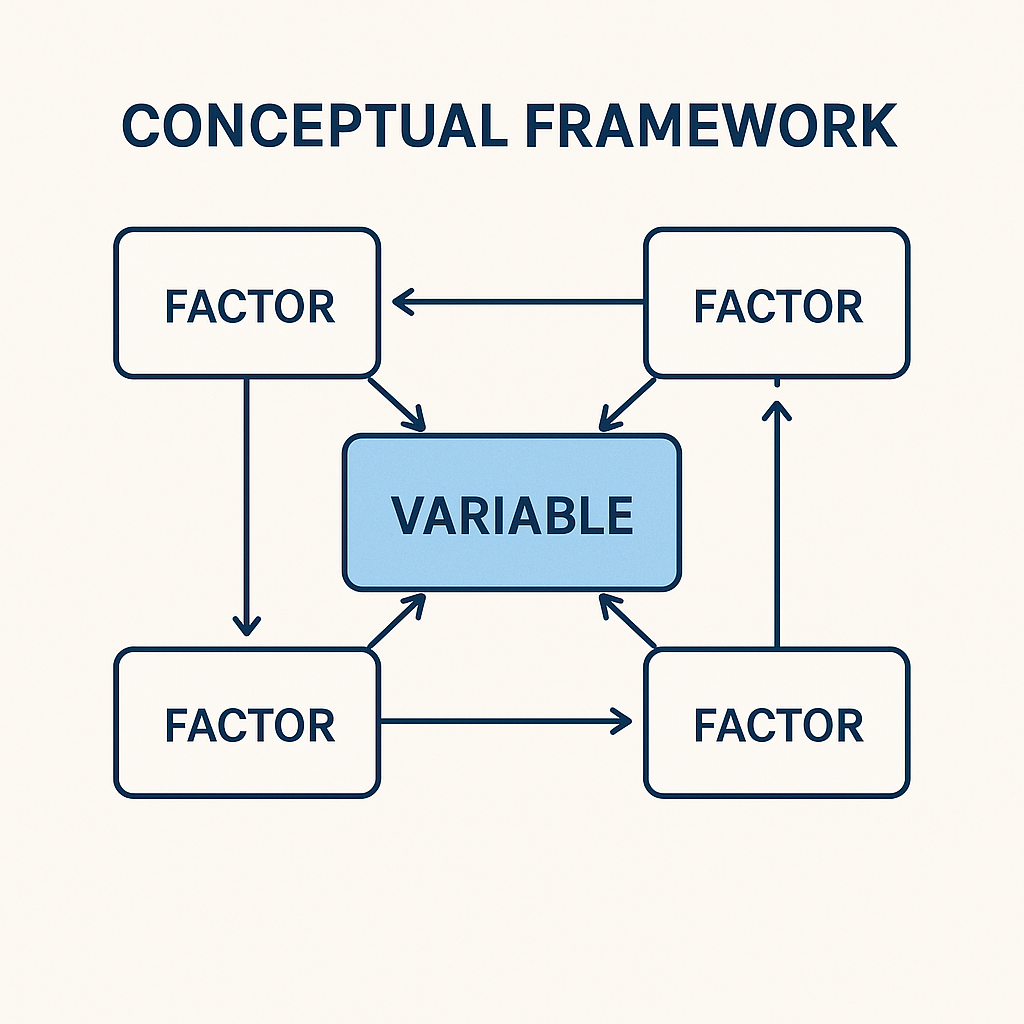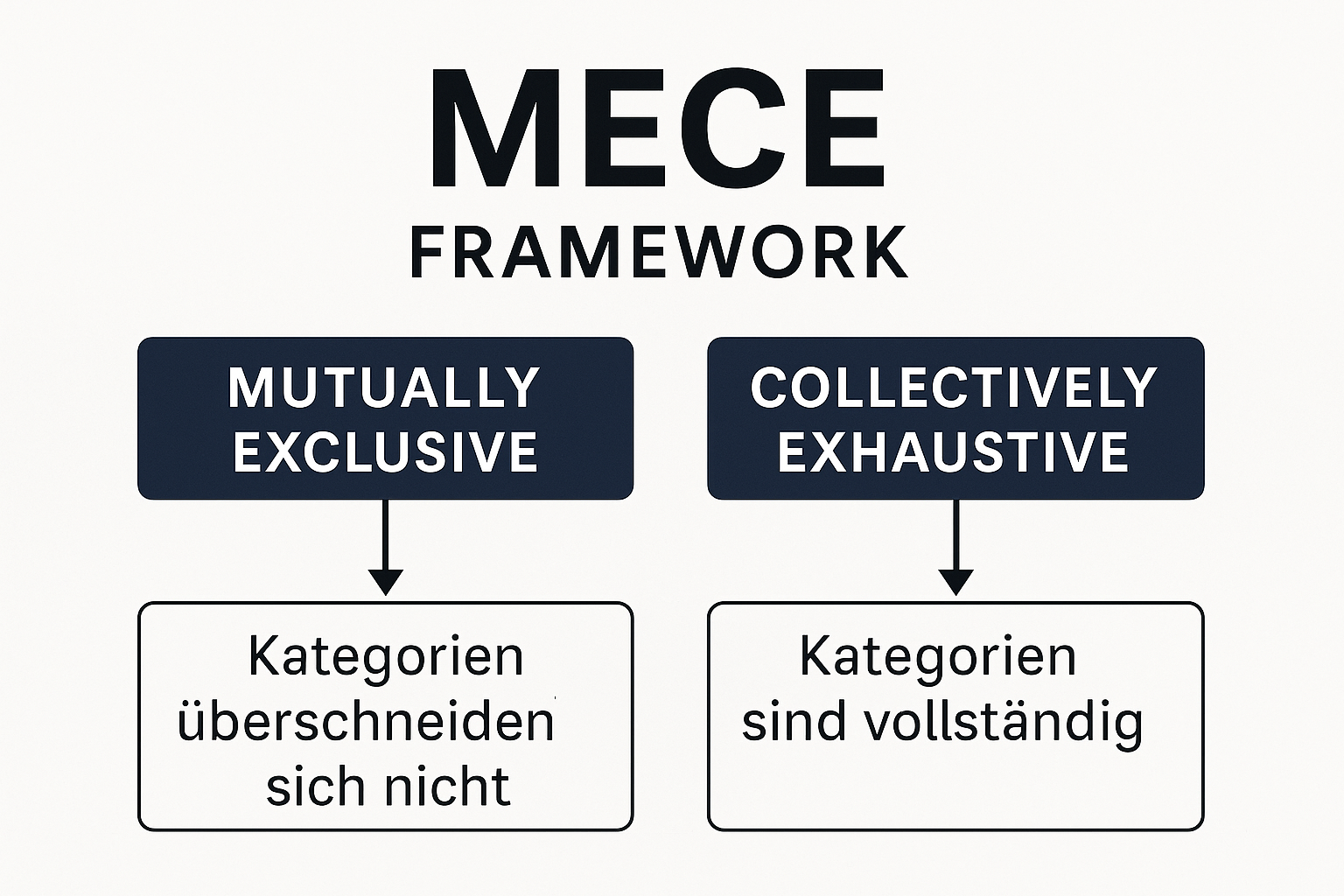Förderung Digitalisierung: Tipps zur staatlichen Förderung
Die digitale Transformation in Unternehmen erfordert oft hohe Investitionen in IT, Software und Know-how. Bund, Länder und EU unterstützen deshalb mit zahlreichen Förderprogrammen (Zuschüsse, zinsgünstige Kredite, Beratungspauschalen) insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In diesem Beitrag werden aktuelle Programme für 2024/2025 erläutert – von EU-Initiativen wie dem „Digital Europe Programme“ über nationale Angebote wie den KfW-Digitalisierungs- und Innovationskredit oder den BAFA-Unternehmensberatungszuschuss bis hin zu Landes-Förderungen (z.B. Digitalbonus Bayern). Außerdem besprechen wir steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten (Sonder-AfA, 1-Jahres-Abschreibung von IT) und alternative Finanzierungswege (Bankkredite, Leasing, Crowdfunding). Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und FAQ unterstützen Sie bei der Antragstellung, ergänzt durch Hinweise auf Förderdatenbanken, Checklisten und Planungs-Tools.
Warum der Staat Digitalisierung fördert
Die Politik sieht in der Digitalisierung einen zentralen Treiber für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Innovationskraft. Digitale Technologien gelten als „General Purpose Technologies“ – also als Quellbreite neuer Innovationen in vielen Branchen. Sie können helfen, Produktivitätstrends zu steigern und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Laut Bundeswirtschaftsministerium sind „Digitalisierung und Innovation die Wachstumstreiber von morgen“ – entsprechend werden Investitionen in digitale Prozesse, Zukunftstechnologien und Künstliche Intelligenz gezielt gefördert. Staatliche Programme sollen KMU den Zugang zu moderner IT, E-Commerce, Cybersecurity und digitalen Geschäftsmodellen erleichtern. So soll Deutschland als Wirtschaftsstandort gestärkt und die digitale Souveränität (z.B. durch Ausbau von 5G/Glasfasernetzen) sichergestellt werden. Außerdem knüpft Deutschland an EU-Ziele zur Digitalisierung an (z.B. europaweite Kompetenzzentren für KI und Hochleistungsrechnen), weshalb es Mittel aus EU-Strukturfonds und Digitalprogrammen akquiriert. Insgesamt schaffen Förderungen wie Investitionszuschüsse, Kredite mit Tilgungsnachlässen oder Steueranreize günstige Rahmenbedingungen, damit insbesondere KMU die oft hohen Anfangskosten der Digitalisierung stemmen können.
Bis zu 80% Förderung vom Staat erhalten
Bei Digitalisierungsvorhaben besteht stets die Möglichkeit einer staatlichen Förderung. ardu-digital ist vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle autorisiert, förderfähige Beratungen durchzuführen. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie bis zu 80 % staatliche Fördergelder erhalten. Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf und lassen Sie sich in einem 15-minütigen Gespräch informieren.
Überblick: Die wichtigsten Förderprogramme 2025
Deutschland und die EU bieten ein vielfältiges Portfolio an Förderinstrumenten für Digitalisierungsvorhaben. Die wichtigsten Programme im Jahr 2025 lassen sich grob in drei Gruppen einteilen:
- EU-Programme: Das Förderprogramm „Digitales Europa“ (Digital Europe Programme, 2021–2027) hat ein Gesamtbudget von ca. 8,2 Mrd.€ und zielt darauf ab, digitale Kapazitäten in Bereichen wie KI, Hochleistungsrechnen, Cybersicherheit und digitale Kompetenzen auszubauen. KMU können sich an Ausschreibungen (Zuschussprojekte) beteiligen. Ergänzt werden diese EU-Mittel durch Forschungsprogramme wie Horizon Europe (F&E-Projekte zu digitalen Themen) und durch Finanzierungsinitiativen (z.B. InvestEU, EIC Accelerator für Startups).
- Bundesprogramme: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet mit dem neuen ERP-Förderkredit Digitalisierung (KfW-Nummern 511/512) und ERP-Förderkredit Innovation (513/514) bis zu 25 Mio.€ zinsgünstige Darlehen für Digitalisierungs- und Innovationsprojekte an. Diese Kredite werden je nach Digitalisierungsgrad mit einem Tilgungszuschuss (bis 5 %, max. 200 T€) kombiniert. Die BAFA-Förderung „Unternehmensberatung“ gewährt einen nicht rückzahlbaren Zuschuss (in der Regel 50 %) für externe Beratungsleistungen zu allen wirtschaftlichen Fragen, darunter Digitalisierung. Weitere Bundesprogramme sind BMBF-Initiativen (z.B. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand für F&E), ggf. Energieeffizienz- und Klimaprogramme mit Digitalisierungskomponente sowie das ehemals aktive Programm „Digital Jetzt“, das KMU mit bis zu 50 % Zuschuss beim Kauf von Hard-/Software und Weiterbildung unterstützte (Programmende 2023).
- Landesprogramme: Fast alle Bundesländer haben eigene Digitalisierungsfonds. Beispiele sind in Bayern der Digitalbonus (Standard bis 7.500 € Zuschuss, Plus bis 30.000 € bei besonders innovativen Vorhaben), in Sachsen die „Digitale Offensive Sachsen“ (EFRE-Zuschüsse für Hard-/Software und Schulung) oder in Nordrhein-Westfalen das MID-Gutscheinprogramm (bis 15.000 € Zuschuss für KMU in den Stufen Digitalisierung, Analyse, Innovation). Hessen bietet etwa einen Digi-Zuschuss (bis 20.000 € für Cloud-, KI-, IT-Security-Projekte). In jedem Land gelten eigene Förderbedingungen und Höhe der Zuschüsse. Eine zentrale Sammelstelle ist die Online-Förderdatenbank des BMWK, die aktuelle Programme (EU, Bund, Länder) auflistet.
Die Förderinstrumente umfassen also Zuschüsse (nicht rückzahlbare Fördergelder), zinsvergünstigte Kredite sowie steuerliche Anreize. In der Praxis kombiniert ein Unternehmen oft Beratungszuschüsse (z.B. BAFA) mit Finanzierungshilfen (KfW-Kredite) – teils ist auch die Kumulierung möglich. Die folgenden Abschnitte erläutern die Angebote von EU, Bund und Ländern im Detail.
EU-Förderprogramme für Digitalisierung
Die EU investiert massiv in den digitalen Wandel. Kernstück ist das Programm „Digitales Europa“ (2021–2027) mit rund 8,2 Mrd.€ Budget. Es verfolgt zentrale Ziele: Aufbau moderner Digitalstrukturen (HPC-Supercomputer), Förderung von KI-Entwicklung und -Einsatz, Stärkung der Cybersecurity, Ausbau digitaler Kompetenzen und Unterstützung der digitalen Transformation in Wirtschaft und Verwaltung. Dazu schreibt die EU periodisch Ausschreibungen aus, auf die sich Konsortien aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Behörden bewerben können (meist als Zuschüsse mit Eigenanteil von 25 % für KMU). Auch das Forschungsprogramm Horizont Europa bietet Calls für digitale Technologien (z.B. Industrie 4.0, IoT, Blockchain). Für innovative Startups ist der EIC Accelerator (ehemals SME-Instrument) interessant, der Zuschüsse plus Beteiligungskapital für Technologie-Pioniere bereitstellt.
Neben speziellen Digitalprogrammen fließen EU-Gelder über Strukturfonds auch in Breitbandausbau und Smart City-Projekte. Zudem fördert die EU über COSME (KMU-Programm) oder den Europäischen Investitionsfonds (EIF) die Finanzierung von mittelständischen Projekten. Kleine Unternehmen profitieren so indirekt von EU-Fördermittelinitiativen, die auf Wettbewerbsfähigkeit und Innovation abzielen. Gesamtziel ist es, Europa als führenden digitalen Standort zu stärken und KMU direkt beim Markteintritt neuer digitaler Geschäftsmodelle zu unterstützen.
Bundesweite Förderungen: Bafa & Co.
Bundesprogramme richten sich vornehmlich an nationale Unternehmen und greifen meist zusätzlich zu EU-Förderungen. Wichtige Angebote sind:
- ERP-Förderkredit Digitalisierung & Innovation (KfW): Seit Juli 2025 laufen zwei neue Kreditprogramme der KfW (511/512 und 513/514), die den alten ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit ersetzen. Sie bieten Darlehen bis 25 Mio.€ mit attraktiven Zinsen und Tilgungszuschüssen (abhängig vom Projektstatus, z.B. bis 5 % des Kreditvolumens). Es gibt drei Förderschienen (Basis, LevelUp, HighEnd) mit steigenden Zuschüssen für komplexe KI/Innovationsvorhaben. Bei allen drei Stufen entfällt ein Mindestkreditbetrag, so dass selbst kleinere Investitionen abgedeckt werden. Ein „Digitalisierungs-Check“ der KfW hilft Antragstellern, ihren Förderbedarf zu ermitteln.
- BAFA-Unternehmensberatung: Das Bundesamt für Wirtschaft (BAFA) gewährt KMU einen Zuschuss (in der Regel 50 %) zu externen Unternehmensberatungen – inklusive Digitalisierungsberatung. Damit können KMU etwa eine Digitalisierungsstrategie entwickeln, Cloud-Migration planen oder IT-Securitykonzepte erstellen. Die Antragstellung erfolgt online (Portal des BAFA), nach Einreichen prüft eine regionale Leitstelle förmlich und vergibt ein Info-Schreiben – erst dann kann die Beratung beginnen. Maximal sind fünf Beratungen pro Unternehmen (davon höchstens zwei pro Jahr) möglich.
- go-digital (BMWK): Bis Ende 2024 lief das Förderprogramm „go-digital“ des Bundeswirtschaftsministeriums. Dabei erhielten KMU bis zu 60 % Zuschuss für autorisierte Beratungsleistungen in drei Modulen (Digitalisierungsstrategie, IT-Sicherheit, digitale Prozesse). Das Programm wurde bis 31.12.2024 verlängert und aufgrund knapper Haushaltsmittel danach eingestellt. Unternehmen konnten bis dahin Förderanträge stellen; eine Restabwicklung für 2025 ist möglich, aber kein neuer Aufruf.
- Digital Jetzt (BMWK, beendet): Bis Ende 2023 unterstützte das Programm Digital Jetzt KMU bei IT-/Software-Investitionen und Weiterbildung (bis zu 50 % Zuschuss, max. 50.000 €). Das Programm lief befristet (2019–2023) und ist derzeit nicht verlängert worden. Seine Nachfolgeprogramme sind (zumindest 2025) der neue KfW-Kredit und Beratungshilfen.
- Weitere Bundeshilfen: Daneben gibt es Förderkredite und Zuschüsse für Branchenprojekte (z.B. „KMU-innovativ“ für Hightech-Forschung, BMBF), sowie Unterstützungen für digitale Infrastruktur (5G-Ausbau, Beamten-IT). Auch Steuerprogramme fließen über Bundesmittel (siehe nächster Abschnitt). Für Gründer ist das BAFA-Programm „INVEST – Zuschuss für Wagniskapital“ interessant: Private Business Angels erhalten bis 40 % Zuschuss auf ihre Investments (bis 50.000 € je Investment).
Anmerkung: Viele Bundesförderungen sind KMU-gerichtet. Programme wie BAFA-Unternehmensberatung oder go-digital verlangen beispielsweise die EU-Definiton für kleine Unternehmen (typisch: weniger als 250 Beschäftigte). Für Großunternehmen gibt es in der Regel eigene Programme (z.B. im Rahmen von Forschungskooperationen).
Länderspezifische Fördermöglichkeiten
Jedes Bundesland hat eigene Digitalisierungsprogramme, oft mit regionalem Fördersatz und Schwerpunkt. Beispiele:
- Bayern – Digitalbonus: Kleine Unternehmen (ab 3 Mitarbeitern) erhalten Zuschüsse zu Digitalisierungs- und IT-Sicherheitsmaßnahmen. Im „Standard“-Zuschuss sind bis zu 7.500 € förderfähig (bis 50 % der Kosten), im „Plus“-Zuschuss bis zu 30.000 € (ebenfalls 50 %) für besonders innovative Projekte.
- Sachsen – Digitale Offensive: Sachsen fördert Hard- und Software sowie Schulungen. Die Richtlinie „Digitale Offensive“ (mit EU-Mitteln) gewährt Zuschüsse für die Einführung neuer IKT-Lösungen oder IT-Sicherheitssysteme. Gefördert werden z.B. ERP-Systeme, Cybersecurity-Tools, Fachkräfteschulungen.
- Nordrhein-Westfalen – MID-Gutscheine: In NRW gibt es das Programm „Mittelstand Innovativ & Digital“. KMU erhalten dort Mittelstandsgutscheine (bis 15.000 €) für Digitalisierungsberatung, Technologieanalyse oder Prototypentwicklung. Für Mikro- und kleine Betriebe beträgt der Zuschuss bis zu 70 %, für mittlere bis zu 50 %.
- Hessen – Digi-Zuschuss, KI-Förderung: Hessen bietet den Digi-Zuschuss Hessen (bis 20.000 € für digitale Anwendungen, z.B. Cloud-Lösungen oder KI-Prototypen) und eigene KI- oder Mittelstandsprogramme (beispielsweise Beratungskostenzuschüsse).
- Weitere Länder: Auch in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Bremen und anderen Ländern gibt es Digitalisierungsfonds (häufig „Digitalbonus“ oder „Digitalzuschuss“ genannt), oft als Bestandteil von Innovations- oder Strukturförderprogrammen. In Rheinland-Pfalz etwa ermöglicht der Innovationskredit RLP Investitionen für Digitalisierung (Kredit über Hausbank, bis 2 Mio.€) und ein Zuschussprogramm für Unternehmensberatung. Eine gute Übersicht bieten die Landesministerien sowie die Förderdatenbank, die regionale Programme zusammenfasst.
Kurz: Neben Bundesmitteln bieten die Länder viele standortspezifische Zuschüsse. Ob Sie Cloud-Software, Online-Shop, IT-Sicherheit oder Prozessautomatisierung planen – in fast jedem Land gibt es ein passendes Programm, das an lokale Branchen oder Unternehmensgrößen angepasst ist. Oft sind diese Zuschüsse unkompliziert (pauschal, hoher Fördersatz) ausgelegt.
KMU-spezifische Digitalisierungsförderungen
Nahezu alle genannten Programme richten sich speziell an KMU (kleinere Unternehmen). Nach der EU-Definition gelten Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden als KMU. Viele Programme setzen hier noch engere Grenzen: So darf bei BAFA-Beratung und go-digital die Unternehmensgröße 100 Mitarbeiter (bzw. 20 Mio.€ Jahresumsatz) nicht überschreiten. Auch in den Landesprogrammen werden Kleinstunternehmer oft bevorzugt (teilweise bereits ab 3 Mitarbeitern). Zudem dürfen Zuschüsse aus EU-Regionalfonds (EFRE/ESF) nur KMU erhalten.
Es existieren aber auch spezielle KMU-Initiativen: So fördert das BMWK Gründer (bis 5 Jahre alt) und kleinste Firmen per ERP-Gründerkredit. Die BMF-Kampagne „Made for Germany“ über InvestEU unterstützt explizit kleine Digitalprojekte. Und Branchennetzwerke (Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren) bieten kostenlose Beratung für KMU. Wichtig ist: Bei allen Programmen können in der Regel nur Unternehmen (keine Großkonzerne) als Antragsteller auftreten. Ausnahmen gelten manchmal für kooperative Projekte (z.B. Forschungskonsortien). KMU sollten daher gezielt nach Programmen suchen, die ausdrücklich ihre Unternehmensgröße adressieren.
Steuerliche Abschreibungen und Vorteile
Neben Fördergeldern bietet das Steuerrecht vergünstigte Abschreibungsmöglichkeiten für digitale Investitionen:
- Sonderabschreibung (Sofortabschreibung): Nach §7g EStG können kleine und mittlere Unternehmen bis zu 40 % der Anschaffungskosten für Digitalisierungshardware und -software in den ersten beiden Jahren zusätzlich abschreiben (bis 2023 waren es 20 %). Damit wird ein Großteil der Ausgaben rascher steuermindernd wirksam.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG): Computer und Software gelten oft als GWG und können bis 800 € sofort komplett abgeschrieben werden. Damit lassen sich kostengünstige IT-Geräte komplett im Anschaffungsjahr steuermindernd ansetzen.
- Verkürzte Nutzungsdauer: Das BMF hat eine einjährige Nutzungsdauer für Computer, Tablets und betriebliche Software erlaubt. Praktisch bedeutet das: Kosten für IT-Systeme können bilanziell wie ein GWG vollständig im Anschaffungsjahr abgesetzt werden, sofern keine aktivierte Bilanz vorliegt.
- Degressive Abschreibung: Im Rahmen des Investitionssofortprogramms 2024-2026 kann degressiv abgeschrieben werden (bis zu 30 % pro Jahr), was vorübergehend die jährlichen Abschreibungen erhöht.
- Investitionsabzugsbetrag (IAB): KMU dürfen nach §7g EStG bis zu 50 % der künftigen Anschaffungskosten digitaler Anlagen vorab gewinnmindernd abziehen (Planungsrücklage). Wird das Investitionsvorhaben realisiert, wird der Abzug aufgelöst. So lässt sich bereits bei der Vorplanungsphase Steuern sparen.
- Weitere Steuervorteile: Aufwendungen für Fortbildung zur Digitalisierung sind als Betriebsausgaben absetzbar. Auch Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen (z.B. zur KI-Entwicklung) genießen ggf. erhöhte Forschungszulage.
Konkret heißt das: Wenn Sie z.B. neue ERP-Software oder Laptops kaufen, können Sie steuerlich oft sofort einen großen Teil der Ausgaben geltend machen. Unternehmen sollten dies gemeinsam mit ihrem Steuerberater planen, um von den aktuellen steuerlichen Förderinstrumenten maximal zu profitieren.
Antragstellung: Schritt-für-Schritt Anleitung
Die Beantragung staatlicher Fördermittel folgt typischen Schritten – wobei Details je nach Programm leicht variieren:
- Förderprogramm wählen: Recherchieren Sie geeignete Angebote (z.B. über die Förderdatenbank des BMWK, IHK, Förderberater). Prüfen Sie Antragsfristen und Voraussetzungen (Branche, Unternehmensgröße, Kostenart).
- Voraussetzungen prüfen: Viele Programme verlangen eine Vorab-Beratungs- oder Bedarfsanalyse. Manche Förderungen (z.B. digitales Investitionsguthaben) setzen voraus, dass das Vorhaben noch nicht begonnen ist. Achten Sie auf EU- bzw. De-Minimis-Grenzen.
- Unterlagen zusammenstellen: Bereiten Sie Projektbeschreibung, Finanzplan und notwendige Nachweise vor (z.B. Umsatz-, Beschäftigten- und Steuerdaten für die KMU-Definition). Häufig erforderlich: Angebot eines Dienstleisters, Aussagen zum Innovationsgehalt oder Schulungsplan.
- Antrag stellen: Reichen Sie den Antrag rechtzeitig elektronisch ein – bei vielen Bundesprogrammen über Online-Portale (z.B. BAFA-Portal für Beratungszuschuss, KfW über Hausbanken, Länder über Fördersysteme). Im BAFA-Beratungsvoucher etwa geben Sie nur Firmendaten ein; die zuständige Leitstelle prüft formale Voraussetzungen. Erst nach positiver Prüfung erhalten Sie ein Informationsschreiben – erst dann dürfen Sie mit der geförderten Maßnahme beginnen.
- Prüfung und Bewilligung: Nach Einreichen prüft die Behörde (oder ein beauftragter Partner) Ihren Antrag und erstellt ggf. einen Votum. Wird das Vorhaben als förderfähig eingestuft, erhalten Sie einen Bewilligungsbescheid mit Auflagen (Fördersatz, Frist zur Projektdurchführung, Verwendungsnachweis). Oft ist ein Eigenanteil vorgesehen, den Sie nachweisen müssen.
- Projektumsetzung: Führen Sie das Vorhaben wie beantragt durch. Dokumentieren Sie alle Kostenbelege und Fortschritte – denn die Ausgaben müssen später nachgewiesen werden. Führen Sie ein transparentes Kostencontrolling; Unterschreitung des Budgets ist meist zulässig, Überschreitung hingegen nicht.
- Verwendungsnachweis: Nach Projektende (oder einem festgelegten Zeitraum, z.B. 6 Monate nach Abschluss) reicht das Unternehmen beim Förderträger einen Verwendungsnachweis ein. Dies kann Abrechnungen, Tätigkeitsberichte und Bestätigungen der geförderten Leistungen umfassen (BAFA-Beratung: Beratungsbericht, Rechnungen, Kontoauszug). Erst nach positiver Prüfung des Verwendungsnachweises wird der Zuschuss endgültig ausgezahlt.
Tipp: Nutzen Sie Checklisten und Muster: Viele Beratungsstellen (IHK, Förderberater) bieten Antrags-Checklisten oder Vorlagen zum Download an. Planen Sie ausreichend Zeit ein (manche Programme arbeiten mit Antragspools bzw. First-Come-First-Serve). Halten Sie Fristen strikt ein – so vermeiden Sie häufige Fehler (siehe unten). Bei komplexen Anträgen kann ein spezialisierter Förderberater helfen.
Häufige Fehler bei der Antragstellung vermeiden
Um die Erfolgschancen zu erhöhen, sollten Sie typische Stolperfallen kennen:
- Unvollständige Anträge: Fehlende Unterlagen oder schlüssige Projektbeschreibungen führen oft zur Ablehnung. Achten Sie darauf, alle geforderten Dokumente beizufügen (z.B. Kostenvoranschläge, Unternehmer-Erklärungen, Nachweise der Gemeinnützigkeit).
- Fristen versäumen: Viele Förderprogramme sind auf Ausschreibungszeiträume beschränkt oder arbeiten mit Quoten. Eine verspätete Antragstellung kann selbst einen guten Antrag zum Scheitern bringen. Reichen Sie daher möglichst früh ein und beobachten Sie die Portalaktualisierungen.
- Fördervoraussetzungen übersehen: Prüfen Sie genau, ob Ihre Firma zu den Voraussetzungen passt (Branche, Standort, Größe, vorheriges Förderverhalten). Ein häufiger Fehler ist das Missachten von Kombinationverboten – manche Programme schließen die Kumulation mit anderen Fördermitteln aus. Lesen Sie Richtlinien sorgfältig und klären Sie Unklarheiten beim Förderträger oder einem Berater.
- Projektstart vor Bewilligung: Beginnen Sie mit Ihrem Vorhaben erst nach erteilter Förderzusage. Tätigkeiten oder Ausgaben „vorab“ akzeptieren Förderstellen nur in Ausnahmefällen; sonst wird der Antrag oft abgelehnt.
- Budgetfehler: Kalkulieren Sie Ihren Finanzbedarf realistisch. Unter- oder Überschreiten des veranschlagten Budgets kann zu Problemen im Verwendungsnachweis führen. Halten Sie sich an den im Antrag bewilligten Kostenvoranschlag.
- Nachweisprobleme: Unzureichende Dokumentation (z.B. fehlende Stundenzettel bei Beratungen, unleserliche Rechnungen) kann zur Rückforderung von Zuschüssen führen. Erfassen Sie von Anfang an alle Belege vollständig.
Merke: Typische Ablehnungsgründe sind unvollständige Anträge, fehlende Wirkungsnachweise und Missachtung von Fristen. Erhöhen Sie Ihre Erfolgschancen durch sorgfältige Vorbereitung – vollständige Unterlagen, zeitgerechte Einreichung und Einholung von Expertenrat.
Alternative Finanzierungsmodelle
Staatliche Fördergelder sind eine wertvolle Unterstützung – sie decken aber oft nur einen Teil der Investitionskosten. Ergänzende Finanzierungswege sind daher häufig nötig:
- Bank- und KfW-Kredite: Klassisch ist der Hausbankkredit, eventuell staatlich refinanziert (z.B. KfW-Unternehmerkredit). Speziell für Digitalisierungsvorhaben bietet die KfW den oben genannten ERP-Förderkredit Digitalisierung mit günstigen Konditionen. Auch klassische Investitionskredite können digitale Projekte finanzieren, oft zu festen oder variablen Zinssätzen.
- Leasing: Für Hardware, Maschinen und sogar IT-Infrastruktur kann Leasing eine sinnvolle Alternative sein. Beim Leasing zahlt das Unternehmen monatliche Raten statt einer hohen Einmalinvestition und kann 100 % der Anschaffungskosten einschließlich Finanzierungskosten abschreiben. Studien zeigen, dass Leasing gerade im Mittelstand Potenzial hat – und speziell für Digitalisierungsprojekte oftmals geeignet ist.
- Factoring: Wenn Liquidität benötigt wird, kann Factoring (Verkauf von Forderungen) helfen. Durch Sofortzahlung eines Großteils der Rechnung durch einen Faktor erhält man schnell Geld, zahlt allerdings eine Gebühr. Für einzelne Projekte (z.B. bei einem Online-Shop-Launch) kann Factoring die Finanzierungslücke überbrücken.
- Crowdfunding / Crowdlending: Für innovative Digitalprojekte gibt es Plattformen (z.B. Startnext, Kapilendo), auf denen viele kleine Investoren Kapital geben. Crowdinvesting (bei Startups oft als Beteiligung) und Crowdlending (als Darlehen) sind in jüngster Zeit populär geworden. Sie bieten zwar keine staatlichen Zuschüsse, können aber vor allem für junge IT-Firmen eine Finanzierungsquelle darstellen.
- Beteiligungskapital / Business Angels: Für wachstumsstarke Digital-Startups ist Venture Capital eine Option. In Deutschland fördert der Staat über die „Investitionszulage Wagniskapital“ (INVEST) private Business Angels mit 25 % Zuschuss auf ihre Beteiligung (bis zu 50.000 € je Beteiligung). Das macht Beteiligungsfinanzierungen für Digitalsunternehmen attraktiver.
- Eigenmittel / Gewinnrücklagen: Gerade bei kleineren Digitalprojekten setzen Unternehmen oft auf eigene Mittel oder die Rücklage von Gewinnen. Das minimiert Fremdkapitalbedarf, kostet aber interne Ressourcen.
- Mix-Finanzierung: Häufig kombiniert ein Unternehmen mehrere Quellen: z.B. 30 % Eigenkapital, 50 % Förderzuschuss und 20 % Bankdarlehen. Dabei gilt: Leasing eignet sich besonders für allgemeine Investitionsgüter und auch zu Digitalisierungszwecken, während Förderkredite gezielt für Innovations- und Digitalisierungsmaßnahmen programmiert sind.
Fazit: Staatliche Förderungen entlasten, doch nicht jedes Projekt wird vollständig über Zuschüsse finanziert. Prüfen Sie daher ergänzende Finanzierungsformen – zinsgünstige Kredite, Leasing oder Beteiligungskapital – um Ihre Digitalinitiativen realisieren zu können. Beispielsweise können Sie einen KfW-Kredit aufnehmen und gleichzeitig einen Zuschuss für einen Teil der Investition erhalten (sofern zulässig). Entscheidend ist: Planen Sie die Finanzierung frühzeitig als Teil Ihres Digitalisierungsprojekts.
Häufige Fragen (FAQ)
In der Regel kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – das heißt Firmen mit weniger als 250 Beschäftigten und Umsatz/Bilanzsumme ≤50 Mio.€. Viele Programme setzen noch engere Grenzen (z.B. <100 Beschäftigte für go-digital). Außerdem muss oft der Sitz bzw. die Betriebsstätte in Deutschland liegen. Einzelunternehmen und Freiberufler sind meist ebenfalls zulässig; Konzerne mit hoher Beteiligung im Inland hingegen nicht. Gemeinnützige Organisationen sind in der Regel ausgeschlossen.
Je nach Programm unterschiedlich. Typisch gefördert werden: hard-/softwaretechnische Investitionen (Server, Rechner, Branchensoftware), Beratungs- und Dienstleistungskosten (z.B. IT-Berater, Prozessberatung), Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. IT-Weiterbildung des Personals) und Personalkosten für digitale Projekte (bei einigen Programmen). Oft werden nur Neuinvestitionen gefördert – Altsoftware- oder Standard-Softwarelizenzen (z.B. Office-Programme) sind meist ausgeschlossen. In manchen Ländern können auch einfache Investitionen wie Website-Erstellung bezuschusst werden. Prüfen Sie immer genau, ob Ihre geplanten Kosten im jeweiligen Richtlinientext aufgeführt sind.
Das variiert stark nach Programm und Unternehmensgröße. Typische Fördersätze liegen zwischen 30 % und 50 % der Ausgaben. Beispielhaft: Der Digitalbonus Bayern fördert 50 % der Kosten, in der Standard-Variante bis 7.500 € Zuschuss; in Baden-Württemberg gibt es ähnliche 50 %-Fördersätze. Es gibt aber auch höhere Fördersätze: In NRW-MID-Gutscheinen werden Kleinstbetrieben bis zu 70 % der Investition erstattet. Manche Landesprogramme setzen feste Pauschalen (z.B. einen Zuschuss von bis zu 10.000 €). Kredite der KfW sind zwar rückzahlbar, bieten aber Tilgungsnachlässe (bis 5 % des Kreditbetrags). Eigenanteile sind in der Regel nötig (häufig mindestens 10–50 % der Kosten), sofern nicht ausdrücklich 100 % Förderung erlaubt ist.
In der Regel online. Beispiele: Für BAFA-Beratung reichen Sie eine Projektskizze mit Kontaktdaten auf dem BAFA-Portal ein. Die BAFA sendet dann nach formaler Prüfung ein positives Infoschreiben. Bei KfW-Krediten beantragen Sie über Ihre Hausbank einen Kredit, die KfW prüft über die Bank. Viele Länder nutzen eigene Förderportale. In allen Fällen sollte man die erforderlichen Unterlagen (Projektbeschreibung, Kostenvoranschlag, Firmenunterlagen) vorher bereithalten. Nach Einreichung erhalten Sie einen Förderbescheid. Erst nach Bewilligung dürfen Sie Kosten abrechnen und das Projekt starten. Planen Sie deshalb den Ablauf ein – je nach Programm kann die Bewilligung mehrere Wochen bis Monate dauern.
Manche Programme sind kontinuierlich geöffnet (Antragstellung jederzeit möglich, z.B. BAFA-Unternehmensberatung oder KfW-Kredit). Andere arbeiten mit zeitlich begrenzten Aufrufen oder Kontingenten (z.B. EU-Förderaufrufe, Digitalbonus-Aufrufe). Viele Zuschussprogramme haben Fristen zum Jahresende oder vorab bestimmte Antragszyklen. Prüfen Sie daher unbedingt die Laufzeit der Förderrichtlinie und die Termine im Förderportal. Ein häufiger Fehler ist das Verpassen der Einreichungsfrist, da manche Programme schon sechs Monate Bearbeitungszeit benötigen. Mindestens drei Monate vor Projektbeginn sollte der Antrag eingereicht sein.
Fragen?
Lassen Sie uns gemeinsam in einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch Chancen und Synergien entdecken.

info@ardu-digital.de
Telefon
0711 57015219
Kontaktiere uns
Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten und uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.
Rufe uns an
+49711 57015219